Zwischen Friedensarbeit und Gewalt – Zur Verleihung des Hessischen Friedenspreises an Jani Silva
Der Hessische Friedenspreis 2024 geht an die kolumbianische Land-, Umwelt- und Friedensaktivistin Jani Silva, Präsidentin der Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA). Seit Jahrzehnten setzt sie sich unter widrigsten Bedingungen für die Rechte einer Gemeinschaft von rund 700 kleinbäuerlichen Familien in Puerto Asís, Putumayo, ein. Diese ist ständig bedroht, insbesondere durch bewaffnete Gruppen, die an der Grenze zu Ecuador illegale Geschäfte betreiben. Seit Jahren erhält Silva Morddrohungen. Das PRIF Spotlight beleuchtet die Hintergründe und Formen des Engagements der Preisträgerin.
Laut Human Rights Defenders Memorial wurden im Jahr 2024 weltweit 324 Menschen umgebracht, die sich in ihren Ländern friedlich für die Menschenrechte einsetzten.1 Fast die Hälfte der Opfer – 157 – entfielen dabei auf Kolumbien. Das südamerikanische Land gehört seit Jahren zu den gefährlichsten Orten für zivilgesellschaftliche Aktivist*innen. Besonders betroffen sind Menschen, die sich in ihren lokalen Gemeinschaften für Umwelt und Landrechte engagieren.2 Diese Problematik hat sich seit dem Friedensabkommen zwischen dem kolumbianischen Staat und der Guerrillaorganisation Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) Ende 2016 noch zugespitzt. Nach Angaben der kolumbianischen Nichtregierungsorganisation Indepaz wurden in den acht Jahren zwischen 2017 und 2024 jährlich im Schnitt 200 soziale Führungspersönlichkeiten (líderes y lideresas sociales) getötet, insbesondere Repräsentant*innen indigener, afrokolumbianischer und mestizisch-kleinbäuerlicher Gemeinschaften in den ländlichen Regionen Kolumbiens.3
Das Department Putumayo im Südwesten Kolumbiens ist von dieser Gewaltform in besonderer Weise betroffen. Als Hochburg des Kokaanbaus und Region an der Grenze zu Ecuador besitzt es strategische Bedeutung für Drogenproduktion und transnationalen Drogenhandel. Zugleich wird Öl gefördert, und der (illegale) Goldabbau boomt. Mit der Demobilisierung der FARC-EP hat zwar die kriegerische Gewalt spürbar abgenommen. An die Stelle der FARC-EP traten allerdings konkurrierende bewaffnete Gruppen, die um die Kontrolle von Bevölkerung, Territorium und illegalen Geschäften ringen. Ergebnis ist ein diffuser Gewaltzusammenhang, in dem sich lokale Gemeinschaften und ihre exponierten Vertreter*innen neben gezielten Morden u.a. Einschüchterungen, Drohungen und Erpressungen, Ausgangssperren, Blockaden und Versuchen der Übernahme von Selbstverwaltungsstrukturen durch illegale Gruppen ausgesetzt sehen.4
In diesem PRIF Spotlight werfen wir einen Blick auf die Situation zwischen Friedensbemühungen und andauernder Gewalt in Puerto Asís, Putumayo. Neben dem Blick auf die Gewaltdynamiken beleuchten wir insbesondere das Engagement der Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA), die ein kleinbäuerliches Schutzgebiet gleichen Namens verwaltet. Zugleich würdigen wir den beharrlichen Einsatz von Führungspersönlichkeiten wie Jani Silva, die trotz widriger Bedingungen die gemeinschaftliche Arbeit zum Aufbau eines territorialen und nachhaltigen Friedens vorantreiben.
Putumayo – Puerto Asís – La Perla Amazónica
Putumayo liegt im Südwesten Kolumbiens und erstreckt sich entlang der Grenze zu Ecuador und Peru von den Ausläufern der Anden bis in die Tiefe des Amazonasgebietes (siehe Karte). Das biodiverse Department hat knapp 400.000 Einwohner*innen, darunter etwa 18,3 % Indigene und 3,8 % Afrokolumbianer*innen. Die legale Wirtschaft basiert neben der Landwirtschaft und Viehzucht vor allem auf dem Erdöl.6 In den 1980er Jahren breitete sich in Putumayo der Kokaanbau aus, und bis Ende der 1990er Jahre etablierte sich das Department als eine der wichtigsten Anbauregionen Kolumbiens, mit der Gemeinde Puerto Asís als Hochburg. Neben dem Zuzug kleinbäuerlicher Siedler*innen ging der Kokaboom mit einer steigenden Präsenz bewaffneter Gruppen einher, darunter paramilitärische Gruppen und die FARC-EP. Im Rahmen des Plan Colombia, der von den USA unterstützten Militäroffensive gegen Drogenproduktion und FARC-EP, wurde der Kokaanbau ab 2000 deutlich zurückgedrängt – gleichzeitig stieg die Gewalt an. Zudem expandierte die Ölindustrie, was zwar Geld und Arbeitsplätze brachte, aber auch Umweltverschmutzung, Landkonflikte und eine verstärkte Militärpräsenz.

Aus der Mobilisierung von Kokabäuer*innen, die sich gegen die breitflächige Besprühung von Kokaplantagen mit Glyphosat wendete, gingen Prozesse der Selbstorganisation ländlicher Gemeinschaften hervor. In Puerto Asís mündeten diese im Jahr 2000 in der Gründung eines kleinbäuerlichen Schutzgebiets (siehe Box). Mit dem sich zuspitzenden bewaffneten Konflikt zwischen FARC-EP, paramilitärischen Gruppen und Staat geriet die Schutzzone allerdings schnell ins Fadenkreuz der bewaffneten Akteure. Nach einer Phase der faktischen Suspendierung und der Vertreibung zahlreicher Familien gelang 2011 die Reaktivierung der Schutzzone, nun repräsentiert und verwaltet durch ADISPA.
Puerto Asís zwischen Friedensprozess und andauernder Gewalt
Die Folgen des Friedensabkommens von 2016 in Putumayo und Puerto Asís sind widersprüchlich.7 Zwar brachte der Friedensprozess der Region einen deutlichen Rückgang bewaffneter Auseinandersetzungen. Auch der Einsatz von Landminen und das Ausmaß gewaltsamer Vertreibungen gingen spürbar zurück. An die Stelle der FARC-EP traten aber neue bewaffnete Gruppen, die um die Kontrolle dieser für Drogenproduktion und -handel strategischen Region konkurrierten. Um 2020 verbündeten sich Abspaltungen der ehemaligen FARC-EP mit der kriminellen Organisation La Constru, die aus der Demobilisierung der Paramilitärs in den frühen 2000er Jahren hervorgegangen war. Die so entstandenen Comandos de la Frontera setzten sich als neuer hegemonialer Akteur in Putumayo durch. Seit 2020 hat sich der Kokaanbau in Putumayo wieder deutlich ausgeweitet. Auch Abholzung, illegale Landnahme und gewaltsame Vertreibungen stiegen erneut an.8
Zwischen 2017 und 2024 wurden in Putumayo 90 soziale Führungspersönlichkeiten getötet, davon allein 19 in Puerto Asís.9 Mit 18,2 Morden pro 100.000 Einwohner*innen ist Putumayo das Department Kolumbiens, das am stärksten von dieser Gewaltform betroffen ist.10 Einschränkungen, Drohungen und Gewalt richten sich insbesondere gegen ländliche Gemeinschaften, die sich wie ADISPA an Initiativen zur freiwilligen Substitution des Kokaanbaus beteiligen, an alternativen Entwicklungsstrategien arbeiten und sich der Kooptation durch bewaffnete Akteure widersetzen.11 Drohungen gegen ADISPA und ihre Repräsentant*innen wurden zuletzt vor allem den Comandos de la Frontera zugeschrieben.12
Gemeinschaftliche Friedensarbeit: Das Beispiel ADISPA
ADISPA verwaltet die kleinbäuerliche Schutzzone La Perla Amazónica und koordiniert die Arbeit der kleinbäuerlichen Gemeinschaften, die ihr angehören.13 Ihre Arbeit zielt darauf, eine gerechtere Landverteilung und lokale Ernährungssouveränität zu gewährleisten, das Gebiet vor Bedrohungen durch Ölförderung, Bergbau, Kokaanbau, Abholzung und nicht-staatlichen Gewaltakteuren zu schützen und ein nach- haltiges Modell ländlicher Entwicklung zu fördern, das ökologische, soziale und produktive Aspekte verbindet. Dabei geht es zugleich um die Erhaltung der kleinbäuerlichen Kultur und, damit eng verbunden, um den Schutz des hochgradig biodiversen, tropischen Feuchtgebiets. Die Bewältigung der Folgen des bewaffneten Konflikts und geschlechtsspezifische Gewalt sind weitere Arbeitsfelder.
Die Organisation hat vier Arbeitsausschüsse. Der Frauenausschuss zielt auf das Empowerment von Kleinbäuerinnen. Der Jugendausschuss stärkt über Tanz und Kultur die kleinbäuerliche Kultur und bindet den Nachwuchs in die Organisationsstrukturen ein. Der Kommunikationsausschuss ist für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, der Ausschuss für Agrarumweltfragen kümmert sich um die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsplanung des Schutzgebiets.14 Besonders hervorzuheben ist die Rolle von Frauen, die als Treiberinnen von Zukunftsvisionen gemeinsam mit ihren Familien Strategien entwickeln, um der Ausbreitung des Kokaanbaus entgegenzuwirken, die Kooperation innerhalb der Gemeinschaft zu stärken und die Zwangsrekrutierung von Jugendlichen durch bewaffnete Gruppen zu verhindern. Zugleich spielen Frauen, wie der Einsatz der langjährigen ADISPA-Präsidentin Jani Silva zeigt, in der Organisation auch zentrale politische Rollen (siehe Box).15
Die Schutzzone und ADISPA sind beständigen Bedrohungen ausgesetzt – insbesondere durch die Ausweitung extraktiver Wirtschaftsaktivitäten und des Kokaanbaus sowie durch nicht-staatliche Gewaltakteure wie die Comandos de la Frontera. In diesem Kontext stehen der Schutz des Territoriums, der kollektiven Identität und der politischen Autonomie im Vordergrund der Gemeinschaftsarbeit.16 Ihr Konzept lokaler Entwicklung folgt einer kollektiven Vision, die globalisierten Wirtschaftslogiken entgegensteht und sich in Mingas (gemeinschaftliche Arbeitsformen indigener und bäuerlicher Gemeinschaften), symbolischem Widerstand und solidarischen Wirtschaftsmodellen ausdrückt.17
ADISPA arbeitet mit staatlichen Institutionen, nichtstaatlichen Organisationen und internationalen Organisationen zusammen. Projekte zielen insbesondere auf die Substitution des illegalen Kokaanbaus durch legale und nachhaltige Alternativen. Durch dieses Engagement steht die Organisation in direktem Konflikt mit den bewaffneten Gruppen, die in der Region Drogenproduktion und -handel kontrollieren.18 Aber auch der Einsatz gegen die Umweltschäden, die durch Erdölförderung und Bergbau hervorgerufen werden, gilt als Grund für die Bedrohungen, denen sich ADISPA und ihre Führungspersönlichkeiten ausgesetzt sehen. Generell steht der kolumbianische Staat der Selbstorganisation ländlicher Gemeinschaften keineswegs nur unterstützend gegenüber. Nach Angaben von Amnesty International war ADISPA-Präsidentin Jani Silva eine von 130 Menschen, deren Kommunikation im Rahmen einer illegalen Cyber-Spio nageoperation des kolumbianischen Militärs überwacht wurde.19 Gleichzeitig erhält sie seit 2017 von einer Einheit des kolumbianischen Staats persönlichen Schutz. Von wirksamen, umfassenden Schutzmaßnahmen, die die gemeinschaftliche Arbeit von ADISPA absichern würden, kann dabei keine Rede sein.20
Schlussbemerkung
Die Arbeit von Organisationen wie ADISPA und das Engagement von Graswurzelaktivist*innen wie Jani Silva stehen für eine Praxis des lokalen, gemeinschaftlichen Friedensaufbaus. Die Bedeutung solcher alltäglicher Friedensarbeit von unten, die etwa Studien über „everyday peace“ (Roger Mac Ginty) und „slow peace“ (Angela Lederach) betonen,21 gerät in Debatten über Krieg und Frieden allzu häufig aus dem Blick. Unter den Bedingungen andauernder Gewalt und vielfältiger Bedrohungen schaffen lokale Gemeinschaften räumlich begrenzte Inseln friedlichen Zusammenlebens. Auch wenn von Frieden im negativen Sinne – verstanden als Abwesenheit kriegerischer Gewalt – noch keine Rede sein kann, arbeiten sie doch zugleich an Grundlagen eines weiterreichenden, positiven Friedens: am Abbau struktureller Gewaltursachen wie Ungleichheit, Exklusion und Umweltzerstörung.
Unter dem Motto eines „territorialen Friedens“ trug das Friedensabkommen mit den FARC-EP der Bedeutung lokaler Gemeinschaften für den Friedensaufbau offiziell Rechnung.22 In der Praxis wurden die Versprechen von lokaler Partizipation, sozialer Teilhabe und ländlicher Entwicklung allerdings bestenfalls partiell eingelöst. Zudem kann in Regionen wie Putumayo von Frieden keine Rede sein. Dies hat sich auch unter der gegenwärtigen Regierung von Gustavo Petro nicht geändert. Petro trat 2022 mit einer umfassenden Friedensagenda (Paz Total) an, die Friedensgespräche mit allen relevanten bewaffneten Gruppen vorsah.23 Im Unterschied zu zahlreichen anderen, bereits gescheiterten, Dialogversuchen dauerten die Gespräche der Regierung mit den Comandos de la Frontera bis zuletzt an.24 Selbst wenn sich die Gruppe auf eine Demobilisierung einlassen sollte, sind die Konsequenzen für die lokale Bevölkerung in Puerto Asís allerdings ungewiss. Während die prekäre Hegemonie der Comandos die Intensität bewaffneter Auseinandersetzungen in der Region zuletzt deutlich reduziert hat, stehen für den Fall ihrer Demobilisierung oder Spaltung konkurrierende bewaffnete Gruppen bereit, um ein entsprechendes Machtvakuum zu füllen.25 Zugleich führt auch die Erdölförderung in der Region fortgesetzt zu Umweltschäden im kleinbäuerlichen Schutzgebiet.26 Das Engagement von ADISPA bleibt damit so bedeutsam wie beständig bedroht.
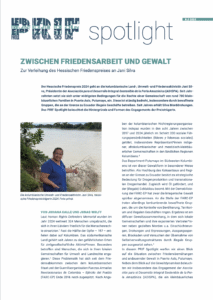
Download (pdf): Johana Calle, Jonas Wolff (2025): Zwischen Friedensarbeit und Gewalt – Zur Verleihung des Hessischen Friedenspreises an Jani Silva. Zur Verleihung des Hessischen Friedenspreises an Jani Silva, PRIF Spotlight 8/2025, Frankfurt/M.
Series
Related Posts
Tags
Author(s)


Latest posts by Jonas Wolff (see all)
- Entre la fachada y la perspectiva política: “Regime Change” en el debate sobre la intervención de EE. UU. en Venezuela - 28. January 2026
- Between Window Dressing and Political Perspective: Regime Change in the Controversy over the US Intervention in Venezuela - 22. January 2026
- Zwischen Feigenblatt und politischer Perspektive: Regime Change in der Kontroverse um die US-Intervention in Venezuela - 19. January 2026