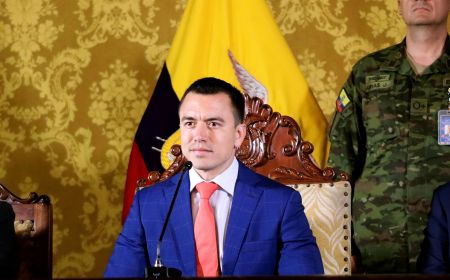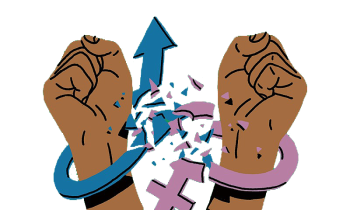Mit Russland verhandeln mittels Drucks und Anreizen
Geht es um Kriege außerhalb Europas, tritt Deutschland für Diplomatie und Verhandlungen ein. Findet der Krieg aber auf dem eigenen Kontinent statt, gelten Verhandlungen mit dem Gegner als unmöglich oder als Konzession gegenüber Kriegsverbrechern. Die sicherheitspolitische Debatte derart zu verengen, blendet jedoch gelungene Risikoreduzierung und diplomatische Erfolge wie z. B. das…