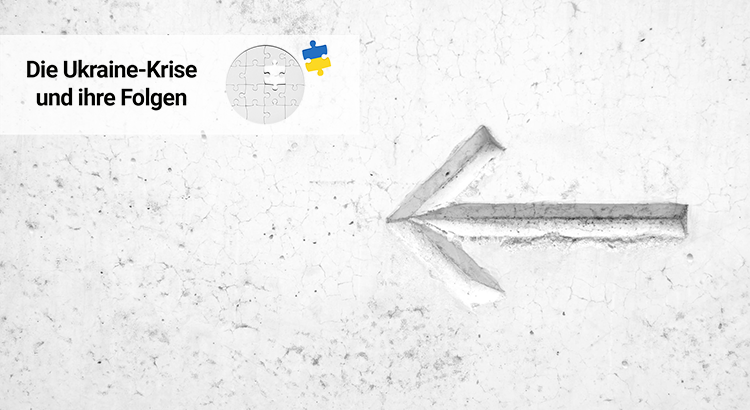Author: Julian Junk
Prof. Dr. Julian Junk ist Projektleiter im Programmbereich „Transnationale Politik“, Leiter der Forschungsgruppe „Radikalisierung“ sowie des Berliner Büros der HSFK. Er forscht zu Radikalisierung und Deradikalisierung in Deutschland und Sicherheitspolitik. // Prof. Dr Julian Junk is project leader in PRIF’s research department “Transnational Politics”, leader of the research group “Radicalization” and head of PRIF’s office in Berlin. His research focusses on radicalization and deradicalization in Germany as well as security policy. | Twitter: @JulianJunk
Eine Sicherheitsstrategie muss notwendigerweise auch eine Freiheitsstrategie sein. Wie bereits in dieser Blogserie zitiert, bekräftigte dies Außenministerin Baerbock: Die Nationale Sicherheitsstrategie ziele auf die Gewährleistung der „Sicherheit der Freiheit unseres Lebens“. „Sicherheit“ und „Freiheit“ sind damit Kernbegriffe der Nationalen Sicherheitsstrategie. Sie stehen aber durchaus in einem Spannungsverhältnis, ergeben sich doch bei Sicherheitspolitik in vielen Feldern auch Freiheitskosten. Diese Kosten und deren Einhegung werden bislang innenpolitisch gewendet und finden ihren Niederschlag in institutionellen Reformvorschlägen zum Bereich der inneren Sicherheit, etwa im Koalitionsvertrag. Die Debatte um die Nationale Sicherheitsstrategie kreist gegenwärtig jedoch primär um außen- und entwicklungspolitische Themen. Damit wird die Chance vertan, Sicherheit tatsächlich umfassend und ressortübergreifend zu denken. Wir diskutieren in diesem Blog, wie Sicherheit und Freiheit in der Nationalen Sicherheitsstrategie in ein produktives Verhältnis gesetzt werden können, wenn auf Erfahrungen aus Debatten über den Freiheitsschutz in der inneren Sicherheit aufgebaut und in der Folge innere und äußere Sicherheit auch institutionell besser verschränkt werden.
Sicherheitspolitische Zeitenwende: Welche Fähigkeiten braucht Deutschland, um den Frieden zu sichern?
Der Krieg in der Ukraine ist eine Zäsur in der deutschen Sicherheits- und Friedenspolitik. Das „Sondervermögen Bundeswehr“ und das Ziel, von nun an zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren, erfordert nicht nur eine Klärung dessen, welche militärischen Fähigkeiten für welche strategischen Ziele benötigt werden. Denn mehr Militär allein wird die Sicherheit nicht bieten, die wir wollen. Notwendig ist eine kohärente sicherheits- und friedenspolitische Gesamtstrategie, die Verteidigungsfähigkeit (inklusive Abschreckung) und zivile Konfliktbearbeitung zusammen denkt. Die Debatte über die Ausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik hat gerade erst begonnen. Der PRIF Blog bietet Kurzanalysen zu zentralen Handlungsfeldern.
HSFK-Blogreihe zur Bundestagswahl 2021: Wohin steuern die Parteien in der Außen- und Sicherheitspolitik?
Am 26. September 2021 wird ein neuer Bundestag gewählt und somit auch über die Zukunft der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik mitentschieden. Wie genau positionieren sich die Parteien und welche Ziele verfolgen sie? In dieser Blogreihe untersuchen Mitarbeiter:innen der HSFK die außenpolitischen Positionen und Ziele der aktuell im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien. Die Beiträge betrachten eine Vielzahl an Politikfeldern und bewerten die friedenspolitischen Herausforderungen, die auf eine neue Bundesregierung zukommen.
The Populist Pandemic Playbook: COVID-19 and the Limits of Right-Wing Populist Government
With the announcement of having contracted Covid-19 in early October, US President Donald Trump followed British Prime Minister Boris Johnson and Brazilian President Jair Bolsonaro among a series of prominent politicians who have fallen ill. All three leaders have since recovered, but their recent illness is not the only thing they have in common: They are also perhaps the three most prominent figures of a global surge in right-wing populism and nationalism that has achieved significant electoral victories from 2016 onwards, yet has largely failed in its crisis management when confronted with COVID-19. The pandemic is sorely testing governments worldwide – populist or otherwise. It shows right-wing, populist governments in action, offering insights into their conceptions of expertise and popular support. Nonetheless, poor handling of the pandemic does not necessarily spell electoral danger for the “Class of 2016” populist leaders.
Macron’s plan for fighting Islamist radicalization – and what Germany and other European countries should and shouldn’t learn from it
On October 2nd French president Macron presented a five-point plan to address Islamist radicalization. The long awaited speech sparked debates in France and beyond. In Germany, some called it “historic” and a “wake-up call”, demanding a similar set of initiatives and central speech for the German debate. This is problematic for two reasons: first, while many measures in Macron’s plan are promising, others and the overall framing of the speech can prove counterproductive in terms of stigmatization and securitization. Second, the French centralist approach cannot and should not be transferred to the German federal and civil society-based system of preventing extremism.
Evaluation der Extremismusprävention – Zur Gestaltung von Qualitätssicherung und Erhöhung der Wirksamkeit
Am 30. Oktober 2019 beschloss das Bundeskabinett ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität – nicht zuletzt in Reaktion auf den rechtsextremen Anschlag auf eine Synagoge in Halle (Saale) drei Wochen zuvor. Ein wesentlicher Aspekt darin ist die langfristige Stärkung der Qualität und Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen – von einschlägigen Ansätzen der politischen Bildung bis zur sicherheitsbehördlichen Arbeit. Stärker als bisher soll also die Evaluation mit Hilfe unterschiedlicher Ansätze und Maßnahmen systematisch mitgedacht werden. Es mangelt jedoch bislang an einer konkreten Strategie, wie diese Ziele erreicht werden können.
Warum wir einen weiten Begriff von Radikalisierung brauchen
Radikalität und Radikalisierung werden heutzutage als zentrale Kennzeichen einer globalen politischen Krise angesehen. Der häufige Bezug auf den Begriff der Radikalisierung in öffentlichen Debatten täuscht jedoch darüber hinweg, wie umstritten der Begriff ist, sowohl in der Frage, auf welche Phänomene er zugreift, als auch mit Blick auf seine normative Bewertung. Heute wird Radikalisierung vorwiegend als Hinwendung zur politischen Gewaltausübung im Kontext von Terrorismus und Extremismus verstanden. Das hat für die Forschung und für die politische Praxis allerdings problematische Konsequenzen. Wir plädieren daher für einen weiten Begriff von Radikalisierung, der die zunehmende grundlegende Infragestellung der Legitimation einer normativen Ordnung und/oder die zunehmende Bereitschaft umfasst, die institutionellen Strukturen dieser Ordnung zu bekämpfen.