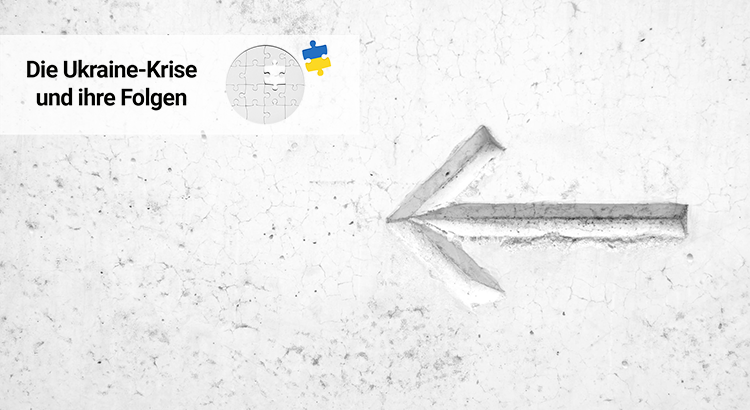Author: Stefan Kroll
Dr. Stefan Kroll ist Leiter der Abteilung für Wissenschaftskommunikation und Senior Researcher im Programmbereich Internationale Institutionen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich interdisziplinärer Normen- und Institutionenforschung, des Wissenstransfers und der politischen Bildung für Themen der Friedens- und Konfliktforschung. // Dr. Stefan Kroll is Head of Science Communication and a Senior Researcher at PRIF’s research department International Institutions. His work focuses on interdisciplinary research on norms and institutions, knowledge transfer, and political education for peace and conflict research topics.. | Twitter: @St_Kroll
Letzte Woche ließen zwei Meldungen besonders aufhorchen: Die eine, nicht neu, dass die größte extremistische Gefahr in Deutschland von Rechtsextremist*innen ausgehe. Die andere, und diese überraschender, dass sich zunehmend auch Teenager radikalisierten. Bei einer bundesweiten Razzia wurde ein 14-Jähriger festgenommen. Das Phänomen wird nicht nur in Deutschland und Europa beobachtet. Auch in Singapur kam es zuletzt zu mehreren Verhaftungen rechtsextremer und auffallend junger Männer. Interessant ist der Fall Singapurs, weil dort die rechtsextremistische Radikalisierung als aus „dem Westen“ importiert verstanden wird. Was wissen wir über das Phänomen dieser transnational-diffundierenden Radikalisierung junger Männer und gibt es Unterschiede in den Erklärungsansätzen?
In the Run-Up to the BRICS+ Summit: Russia’s BRICS+ Soft Power Offensive in Fashion and Sport
Isolating Russia is a key element of the West’s response to Russia’s war of aggression against Ukraine. However, this strategy has only been partially successful. After more than two years of fighting, Russia has found ways to circumvent economic sanctions and political exclusion. This year’s BRICS+ summit, to be held in Kazan in October, is likely to illustrate this development. Russia will host a summit of the highest political and economic importance, bringing together leading powers from different regions of the world. This Spotlight unpacks and evaluates the effectiveness of Russia’s efforts to counter Western isolationist strategies by using soft power initiatives in the areas of fashion and sport in the run-up to the summit.
With or Without you: Climate Policy After the US Elections
The potential re-election of Donald Trump would be a setback for the US climate policy of recent years. Although emissions reductions remain insufficient, climate policy has been a priority under President Joe Biden. The attempts to find a cooperative format with China despite geopolitical tensions deserve special attention, as I argue in this blog post. This approach could also set an example for European and German foreign policy if Trump is re-elected. In any case, Germany and Europe must assume even greater responsibility and leadership in this policy area. This means meeting their own commitments and helping others to do the same.
Kein Innehalten und keine Zäsur – es geht einfach weiter
US-Präsidentschaftskandidat Donald J. Trump entgeht einem Attentat. Bereits Sekunden nach der Tat ballt Trump die Hand zur Faust und fordert seine Anhänger auf, den Kampf fortzuführen. Er schafft ein ikonisches Bild, das den weiteren Wahlkampf und den Ausgang der Wahl beeinflussen wird. Gleichzeitig illustriert die Geste unmittelbar, dass dieses Attentat wohl nicht zu einer notwendigen Zäsur in diesem Wahlkampf führen wird.
Politisierung in Zeiten schwacher politischer Normen: Zum Klima-Gutachten des Internationalen Seegerichtshofs
Ende Mai legte der Internationale Seegerichtshof ein mit Spannung erwartetes Gutachten vor. Eine Gruppe kleiner Inselstaaten hatte den Seegerichtshof im Dezember 2022 angerufen, um die Frage zu klären, was die Pflichten der Vertragsstaaten des Seerechtübereinkommens für den Klimaschutz umfassen. Der Seegerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass die Staaten verpflichtet sind, die Meeresverschmutzung zu verhindern. Auch wenn das Gutachten rechtlich nicht bindend ist, dürfte es Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Rechtsprechung zum Klimaschutz haben. Zugleich ist fraglich, wie groß die normative Wirkung des Gutachtens sein kann, da die über den Kern des Völkerrechts hinausgehende regelbasierten Ordnung zurzeit an Bedeutung verliert.
A Green Recovery for Ukraine: How to Avoid the Trap of Green Colonialism?
The environment is not a silent victim in Russia’s war against Ukraine; the long-term threats for the people of Ukraine are already visible. The environmental dimension of the war has been documented from early on. In this respect, the war is a model for future military conflicts. President Zelenskyy emphasized in his peace plan that green reconstruction is an essential element for a just and sustainable future. Green reconstruction, as every reconstruction, needs international support and local engagement. In this blog post, we identify the conditions that must be met to ensure that local groups are empowered and new international dependencies are avoided.
Nachhaltig wehrhaft?
Die erste Nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland ruht auf drei Säulen. Wehrhaft, resilient und nachhaltig soll Sicherheit zukünftig gestaltet sein. In diesem Blog diskutieren wir die Verknüpfung der wehrhaften und der nachhaltigen Sicherheit und zeigen dabei eine bedeutende Lücke auf. Ausgerechnet bei der so wichtigen Verknüpfung von Klimaveränderung und Sicherheit findet sich kein Hinweis darauf, dass auch die Ausstattung und Infrastruktur der Bundeswehr und ihre Einsatzpläne dem Ziel der Nachhaltigkeit entsprechen sollten. Ein Ansatz der integrierten Sicherheit sollte diese Dimension der nachhaltigen Wehrhaftigkeit aber unbedingt einschließen. Entsprechend empfehlen wir der Bundeswehr, nun eine eigene Strategie zur Klimasicherheit zu erarbeiten.
Die Klimakrise in der Nationalen Sicherheitsstrategie
Der Klimawandel ist eine sicherheitspolitische Bedrohung, in der sich die äußere und die innere Sicherheit berühren. Im besten Fall gelingt es in der Nationalen Sicherheitsstrategie, beides zukünftig stärker zu verschränken. Für die äußere Sicherheit sollte die Strategie nicht allein auf einen werteorientierten Multilateralismus demokratischer Staaten zielen. Die Bewältigung der globalen Risiken des Klimawandels kann nur durch Kooperationen auch mit autokratischen Regierungen wie beispielsweise China gelingen. Für die innere Sicherheit besteht die Chance der Strategie darin, zu einer Veränderung der Risikowahrnehmung in der Bevölkerung beizutragen und hierdurch neben der Resilienz auch die Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels zu fördern.
Sicherheitspolitische Zeitenwende: Welche Fähigkeiten braucht Deutschland, um den Frieden zu sichern?
Der Krieg in der Ukraine ist eine Zäsur in der deutschen Sicherheits- und Friedenspolitik. Das „Sondervermögen Bundeswehr“ und das Ziel, von nun an zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren, erfordert nicht nur eine Klärung dessen, welche militärischen Fähigkeiten für welche strategischen Ziele benötigt werden. Denn mehr Militär allein wird die Sicherheit nicht bieten, die wir wollen. Notwendig ist eine kohärente sicherheits- und friedenspolitische Gesamtstrategie, die Verteidigungsfähigkeit (inklusive Abschreckung) und zivile Konfliktbearbeitung zusammen denkt. Die Debatte über die Ausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik hat gerade erst begonnen. Der PRIF Blog bietet Kurzanalysen zu zentralen Handlungsfeldern.
Frieden am Ende? Die Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt und die Rolle der Friedenspolitik
Russland hat den Krieg begonnen. Der Angriff auf die Ukraine und die Anerkennung der „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk sind ein offener Bruch des Völkerrechts und eine machtpolitische Aggression gegen die bestehende Weltordnung. Die unmittelbaren Opfer sind die Menschen in der Ukraine. Die Kritik und Erbitterung des Westens ist groß. Ebenso die Enttäuschung über das Scheitern der eigenen Deeskalationsbemühungen. Ist mit dem Frieden auch die Friedens- und Sicherheitspolitik am Ende? Und mehr noch: War der Kurs der Vergangenheit, auf Diplomatie, Ausgleich und gemeinsame Sicherheit zu setzen verkehrt, wie jetzt von vielen behauptet wird?