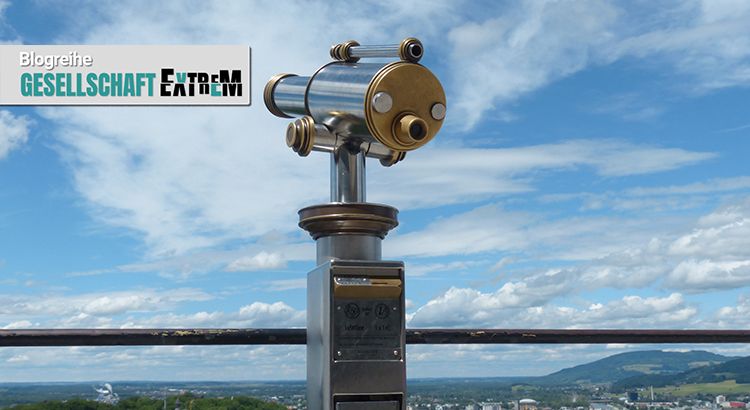Schlagwort: Extremismusprävention
Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wird die Praxis der Extremismusprävention und Deradikalisierung in Deutschland von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gemeinsam umgesetzt. Der Schwerpunkt zivilgesellschaftlicher Aktivitäten liegt dabei überwiegend in der pädagogischen Arbeit. Zivilgesellschaftliche Träger nehmen in Deutschland eine vergleichsweise herausragende Stellung ein und sind fester Bestandteil der Strategie zur Extremismusbekämpfung. Nichtsdestotrotz wird die konkrete Arbeit der Extremismusprävention von den Sicherheitsbehörden zuallererst als Teilaspekt einer breiter angelegten Sicherheitspolitik angesehen. Effektive und nachhaltige pädagogische Arbeit wird meist als zweitrangig betrachtet und dem sicherheitsbehördlichen Blickwinkel untergeordnet. Eine solch kurzsichtige Strategie schürt Misstrauen und kann langfristig die Integrität deutscher Extremismusprävention und Deradikalisierung gefährden.
Weder übertreiben noch ignorieren: Religion in der praktischen Deradikalisierung und Extremismusprävention
Religion ist kompliziert: Besonders im öffentlichen Diskurs wird „dem Islam“ häufig ein inhärenter Hang zu religiös begründeter Gewalt und Terrorismus unterstellt. In der wissenschaftlichen Debatte jedoch ist der tatsächliche Einfluss von Ideologien, und als solche muss eine politisierte Form von z.B. Islam verstanden werden, auf (De-)Radikalisierungsprozesse durchaus umstritten. Bisweilen wird sogar der Ausschluss von Religion aus Präventions- und besonders Deradikalisierungsmaßnahmen gefordert. Die Erfahrungen der Praxis sprechen allerdings für einen Einbezug von Religion in die Extremismusprävention, ohne ihren Stellenwert zu überhöhen.
Warum wir nicht vom „Extremismus“ reden sollten
In der sozialwissenschaftlichen Debatte über Radikalisierung hat es sich – wie im politischen Raum – eingeschliffen, von Extremismus und Extremist*innen zu reden. Doch gerade wenn es darum geht, Prozesse zu verstehen, die in der Befürwortung von Gewalt und schließlich in Gewalthandeln enden, ist die Rede vom Extremismus nicht nur intellektuell unbefriedigend, sondern politisch fatal. Das Extremismuskonzept geht vielen in der Diskussion leicht über die Lippen, weil es unterschiedliche Entwicklungen zusammenfasst, die eine offene Gesellschaft in Frage stellen. Es schafft aber keinen Erkenntnisgewinn – und wirft eine Reihe neuer Probleme auf: die Rede vom Extremismus vernebelt den Blick auf gesellschaftliche Probleme, sie entlässt Akteure aus der Verantwortung, die in diese Probleme verstrickt sind und sie distanziert diejenigen, die mit Deradikalisierungsprogrammen erreicht werden müssen.
Radikalisierungsprävention – Alles da, wo es sein muss?
Die Radikalisierungsprävention hat sich in den vergangenen fünf Jahren zu einem bedeutsamen Handlungsfeld entwickelt. Bund, Länder und Kommunen entwickelten mit hohem Tempo und viel Geld Programme und Maßnahmen, die einen Beitrag zur Eindämmung des gewaltbereiten Salafismus leisten sollen. Soweit die gute Nachricht. Angesichts der kaum noch überblickbaren Präventionslandschaft stellen sich aber auch kritische Fragen: Finden die Aktivitäten dort statt, wo konkreter Bedarf besteht? Darüber hinaus werden die Regelakteure in Schule und Jugendhilfe noch nicht ausreichend berücksichtigt.
Ein Plädoyer für gegenstandsangemessene Evaluationsforschung
Die Herausforderungen durch den islamistischen und rechtsextremistischen Terrorismus führen nicht nur zu verstärkten Bemühungen im Bereich der Radikalisierungsprävention. Damit einher gehen auch Anforderungen an die Evaluationsforschung, die Wirksamkeit von Projekten der Radikalisierungsprävention systematisch zu überprüfen, Wirksamkeitsnachweise zu liefern und evidenzbasiert – so zumindest die Idee – wirksame von unwirksamen Projekten sauber zu trennen. Die komplexe Realität schlägt jedoch solchen Vorstellungen – wie so oft – ein Schnippchen.
Persönlichkeit oder Gruppe: Wo liegen die Wurzeln extremistischer Radikalisierung?
Diese oder ähnliche Fragen werden nach gewaltsamen Vorfällen häufig zuerst in den Medien aufgeworfen. Was wissen wir über den Täter? Was war das für eine Person? Die Öffentlichkeit hat ein großes Bedürfnis zu verstehen, warum sich gerade eine bestimmte Person radikalisiert hat. Auch der Prävention oder der Justiz würden eindeutige Antworten sehr weiterhelfen. Leider ist die Frage nach den individuellen Faktoren kompliziert und kann eher in die Irre führen. Wir blenden den Einfluss der Umwelt aus, wenn wir eine Ursache ‚in der Person‘ finden, vielleicht eine psychische Störung oder Krankheit. Die Forschung zeichnet ein anderes Bild.
Das (zu) weite Feld der Prävention oder: Wo Prävention beginnen und enden sollte
Unter dem Label „Radikalisierungsprävention“ wird eine Vielzahl von unterschiedlichsten Maßnahmen gefördert. Prävention wird dabei in den verschiedensten Formen umgesetzt. Teilweise lässt sich jedoch kaum der präventive Gehalt mancher Angebote erkennen: in diesen Fällen wäre es ratsam, erst gar nicht von Prävention zu sprechen. Geboten ist dies vor allem, weil eine solche begriffliche Überdehnung die in der Präventionsrhetorik angelegten Pathologisierungen und Stigmatisierungsproblematiken unnötigerweise vervielfacht.