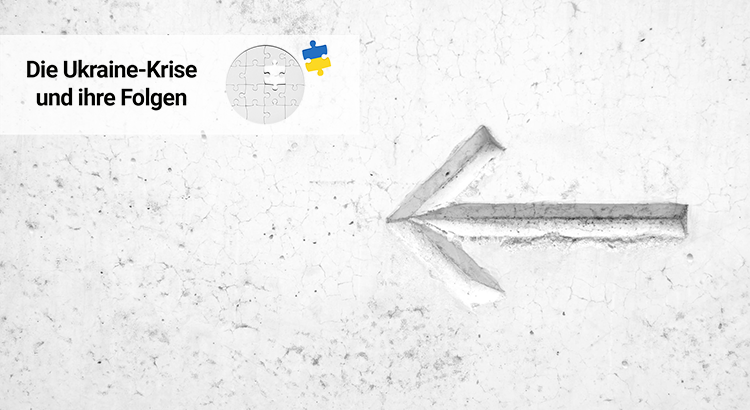Author: Matthias Dembinski
Dr. Matthias Dembinski ist assoziierter Forscher im Programmbereich Internationale Institutionen am PRIF. Er forscht zu Fragen von Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen, regionalen Sicherheitsorganisationen und humanitären Interventionen. Sein regionaler Schwerpunkt ist Westeuropa. // Dr. Matthias Dembinski is an Associate Fellow at PRIF’s Research Department International Institutions. His research interests are questions of justice in international relations, regional security organisations and humanitarian interventions. His regional focus is Western Europe.
Krieg ist kein unvermeidbares Schicksal und eine friedliche Welt ist möglich – dieser Optimismus der Friedensforschung wird durch Russlands Angriffs- und Eroberungskrieg einer harten Bewährungsprobe ausgesetzt. Jenseits der drängenden Frage, wie der Krieg gegen die Ukraine beendet werden kann, stellt sich der Friedensforschung ein grundlegendes Problem: Wie kann eine wirklich friedliche Weltordnung heute überhaupt noch aussehen? Der Versuch, Frieden durch Verflechtung und Angleichung zu schaffen, ist im Fall Russlands gescheitert. Kann Frieden durch Abgrenzung eine tragfähige Alternative darstellen?
Die NATO nach dem Gipfel von Vilnius: neue Stärke, ungewisse Zukunft
Der Gipfel in Vilnius unterstreicht eines: Die NATO ist wieder die zentrale sicherheitspolitische Organisation in Europa und darüber hinaus. Ihre Handlungsfähigkeit verdankt sie nicht zuletzt ihrer hegemonialen Figur. Was heute gut funktioniert, wird angesichts der Unwägbarkeiten der amerikanischen Führungsrolle zum Risiko für morgen. Signale für eine Stärkung der europäischen Eigenverantwortung gingen von dem Gipfel nicht aus. Im Gegenteil erteilt er Vorhaben der EU für eine eigenständigere Verteidigung eine Absage. Zukunftsfähig ist dieses Modell nicht.
Der Platz der Ukraine in der europäischen Sicherheitsordnung: Konturen einer Debatte II
Die Diskussion um die Frage, wie sich die Sicherheit der Ukraine nach dem Krieg garantieren ließe, ist voll entbrannt. Wenn sich der Weg in die NATO als nicht gangbar erweisen sollte, welche Alternativen böten sich an und wie sind sie zu bewerten? In dem zweiten Blogbeitrag zu dem Thema geht es um Sicherheitsgarantien durch umfassende militärische Unterstützung, durch die Stationierung westlicher Truppen, durch die Aussicht auf EU-Mitgliedschaft und durch Arrangements, die auch russische Sicherheitsinteressen berücksichtigen.
Der Platz der Ukraine in der europäischen Sicherheitsordnung: Konturen einer Debatte I
Die Diskussion über den Platz der Ukraine in einer künftigen europäischen Sicherheitsordnung ist voll in Gange. Erste Weichen werden auf dem NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli in Vilnius gestellt. Ob, wann und wie die Ukraine der Allianz beitreten könnte, ist allerdings umstritten. Diskutiert werden daher vier Alternativen: Sicherheitsgarantien durch umfassende militärische Unterstützung, durch die Stationierung westlicher Truppen, durch die Aussicht auf EU-Mitgliedschaft und durch Arrangements, die auch russische Sicherheitsinteressen berücksichtigen. Bei dieser Entscheidung können die Weichen auch falsch gestellt werden – mit weitreichenden Folgen für die europäische Sicherheit. Anlass genug, um in diesem und dem folgenden Blogbeitrag die Vorschläge zu bewerten.
Decoupling and the “New Cold War”: Cautionary Lessons from the Past
An emerging “new Cold War” appears to pit democracies, led by the US, against autocracies, led by Russia and China. But the analogy between today’s regime competition and that of the “old” Cold War is deceptive. China and Russia today are much more closely intertwined with Western democracies than the Soviet Union ever was. These linkages will complicate the conflict considerably. There is already growing pressure to engage in “decoupling”, that is, to break these interdependencies. Research on past instances of decoupling shows that such processes often exacerbate conflict. This research offers four lessons about the general dynamics of decoupling – and little cause for optimism about today’s disengagement processes.
Zeitenwende: Die nationale Sicherheitsstrategie und die multilaterale Einbettung deutscher Sicherheitspolitik
73 Jahre nach der Gründung ihrer zwei Teilstaaten gibt sich Deutschland erstmals eine nationale Sicherheitsstrategie. Was dies bedeutet und wie weit die Bundesrepublik den Weg gehen wird, den der Titel andeutet, ist dabei alles andere als klar. Unklar ist insbesondere, inwieweit eine nationale Perspektive die bisherige sicherheitspolitische ‚Philosophie‘ der Einbettung in immer engere multilaterale Strukturen von EU und NATO verändert. Trotz aller Kontinuität, so die These dieses Beitrages, wird die Sicherheitsstrategie das spannungsreiche Verhältnis zwischen nationaler Verantwortung und multilateraler Einbettung weiter verschieben. Statt multilaterale Institutionen als Akteur zu begreifen, treten die Staaten, die innerhalb der Institutionen handeln, ins Rampenlicht der deutschen Wahrnehmung.
Russlands Einflussnahme auf dem afrikanischen Kontinent
Sergei Lawrows jüngste Afrikareise unterstreicht noch einmal, dass Russland international keineswegs so isoliert ist, wie wir uns das im Westen wünschen. Sie bestätigt das Bild, das schon bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung Anfang März über die Resolution zur Verurteilung der russischen Invasion sichtbar wurde. Damals enthielten sich rund 25 der 55 afrikanischen Länder, darunter Schwergewichte wie Mosambik, Angola, Sudan, Südafrika und Mali. Während die VertreterInnen anderer Länder gar nicht erst erschienen, stimmte Eritrea sogar gegen eine Verurteilung. Diese Haltung überrascht auch deshalb, weil Russland mit dem Überfall auf die Ukraine erklärtermaßen zwei Normen verletzt, die in besonderer Weise konstitutiv sind – gerade für afrikanische Sicherheit: Zum einen das Uti possidetis-Prinzip, demzufolge bestehende Grenzen nicht verändert werden dürfen, ganz unabhängig davon, wie historisch ungerecht ihr Zustandekommen gewesen sein mag und ob sie anderen Prinzipien wie dem der nationalen Selbstbestimmung entgegenstehen; zum anderen das Verbot des erzwungenen Regimewechsels.
Der Hund, der nicht bellt: Cyber-Operationen im Ukraine-Krieg
Staaten und internationale Organisationen wie die NATO und die EU begreifen Cyberangriffe als zentrale sicherheitspolitische und militärische Bedrohung und bereiten sich seit Jahren auf derartige Szenarien vor. Die sicherheitspolitische Fachwelt sieht in Russland einen besonders aggressiven Akteur im Cyberraum und rechnete damit, dass die Führung in Moskau Cyberangriffe gegen kritische Infrastrukturen ihrer Gegner im Vorfeld von und parallel zu kinetischen militärischen Operationen durchführen würde. Verglichen mit diesen Erwartungen sehen wir im russischen Krieg gegen die Ukraine bisher nur wenig Anzeichen für solche Angriffe aus dem digitalen Raum.
Sicherheitspolitische Zeitenwende: Welche Fähigkeiten braucht Deutschland, um den Frieden zu sichern?
Der Krieg in der Ukraine ist eine Zäsur in der deutschen Sicherheits- und Friedenspolitik. Das „Sondervermögen Bundeswehr“ und das Ziel, von nun an zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren, erfordert nicht nur eine Klärung dessen, welche militärischen Fähigkeiten für welche strategischen Ziele benötigt werden. Denn mehr Militär allein wird die Sicherheit nicht bieten, die wir wollen. Notwendig ist eine kohärente sicherheits- und friedenspolitische Gesamtstrategie, die Verteidigungsfähigkeit (inklusive Abschreckung) und zivile Konfliktbearbeitung zusammen denkt. Die Debatte über die Ausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik hat gerade erst begonnen. Der PRIF Blog bietet Kurzanalysen zu zentralen Handlungsfeldern.
Frieden am Ende? Die Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt und die Rolle der Friedenspolitik
Russland hat den Krieg begonnen. Der Angriff auf die Ukraine und die Anerkennung der „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk sind ein offener Bruch des Völkerrechts und eine machtpolitische Aggression gegen die bestehende Weltordnung. Die unmittelbaren Opfer sind die Menschen in der Ukraine. Die Kritik und Erbitterung des Westens ist groß. Ebenso die Enttäuschung über das Scheitern der eigenen Deeskalationsbemühungen. Ist mit dem Frieden auch die Friedens- und Sicherheitspolitik am Ende? Und mehr noch: War der Kurs der Vergangenheit, auf Diplomatie, Ausgleich und gemeinsame Sicherheit zu setzen verkehrt, wie jetzt von vielen behauptet wird?