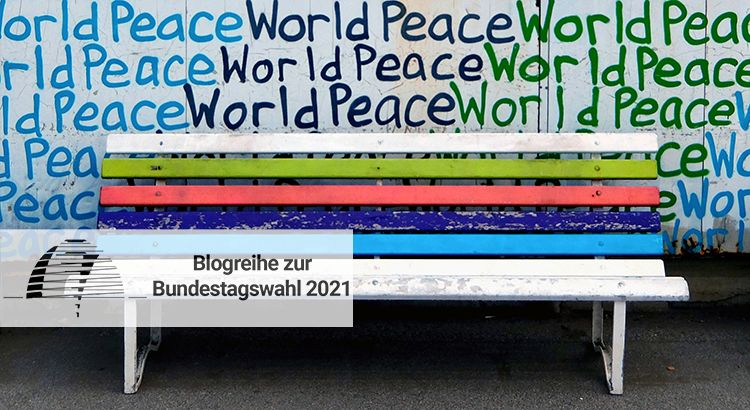Schlagwort: Deutschland
Nach der Machtübernahme der Taliban kam der Ruf nach Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes...
Mit Außenpolitik kann man keine Wahlen gewinnen, ohne Außenpolitik aber keine Zukunft
Als inhaltsleer wurde der gegenwärtige Wahlkampf schon oft und nicht zu Unrecht geschimpft. Doch...
Zäsur ohne Konsequenz: Die deutsche Russlandpolitik und das Ende der Ära Merkel
Mit Außenpolitik sind keine Wahlen zu gewinnen. Dennoch kommt man am Thema Russland nicht vorbei...
Mehr Peacebuilding wagen? Die Parteipositionen zu Konfliktbearbeitung und Friedensförderung im Vergleich
Frieden ist weitaus komplexer als nur das Schweigen der Waffen. Die Herstellung friedlicher...
Krisenprävention als Schwerpunkt deutscher Außenpolitik? Ein Blick in die Wahlprogramme der Parteien
Kurz vor der Bundestagswahl 2017 wurden die Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte...
Zusammenarbeit mit Afrika: Parteipolitische Positionen im Vergleich
In ihren afrikapolitischen Leitlinien von 2019 beschreibt die amtierende deutsche Bundesregierung...
Deutsche Demokratieförderpolitik in einer multipolaren Welt: Parteipolitische Perspektiven vor der Bundestagswahl
Ob in Brasilien oder Indien, in den USA, Tunesien oder Ungarn – selten seit dem Ende des Kalten...
Eine feministische Außenpolitik für Deutschland?
Seit Schweden im Jahr 2014 offiziell eine feministische Außenpolitik verfolgt, wird der Begriff...
HSFK-Blogreihe zur Bundestagswahl 2021: Wohin steuern die Parteien in der Außen- und Sicherheitspolitik?
Am 26. September 2021 wird ein neuer Bundestag gewählt und somit auch über die Zukunft der...
Gut gemeint genügt nicht: Die Aussöhnung mit Namibia braucht die Zustimmung lokaler Opfergruppen
Seit Jahren hat Deutschland mit Namibia über ein Aussöhnungsabkommen verhandelt, das die...