Die 4. Überprüfungskonferenz des Kleinwaffenaktionsprogramms war überschattet vom Streit zwischen den Staatenvertretern um die Frage, ob Munition miteinbezogen werden sollte. Am Ende gab es eine für das ansonsten um Konsens bemühte Verhandlungsverfahren eine ungewohnte Abstimmung, die von der großen Staatenmehrheit auch gegen den erklärten Widerstand der USA und Israels gewonnen werden konnte. Das Abschlussdokument enthält weitere Neuerungen und stärkt den Prozess der künftigen Umsetzung des Dokuments. Dennoch klafft eine Lücke zwischen den Absichtserklärungen der Staaten und den Konfliktrealitäten und der illegalen Verbreitung von Klein- und Leichtwaffen weltweit.

Große Vision, kleiner Schritt. Macrons Interventionsinitiative und die Folgen
Im September 2017 lancierte der französische Staatspräsident seine „Europäische Interventionsinitiative“, mit der er Europas Fähigkeit, militärisch auf Krisen zu reagieren, erhöhen wollte. Acht weitere Staaten, darunter auch Deutschland, haben sich nun dieser Initiative angeschlossen. Ihre gemeinsame Absichtserklärung vom 25. Juni 2018 bleibt aber deutlich hinter dem zurück, was Macron angeregt hatte. Vor allem wurde bei weitem keine „europäische Interventionstruppe“ eingerichtet, wie teilweise berichtet wurde. Was aber wurde da tatsächlich auf den Weg gebracht, welche Rolle spielt Deutschland dabei und wo besteht weiter Klärungsbedarf?
Die Wahlen vom 24.06.2018 und ihre Auswirkungen auf die christlichen Minderheiten der Türkei
Mit dem Eintritt der radikal-nationalistischen MHP in die türkische Regierung könnte sich feindliche Stimmung gegen die christlichen Minderheiten im Lande noch verstärken. Gleichzeitig erzielte mit der pro-kurdischen HDP eine Partei beachtliche Ergebnisse, die sich explizit mit ihrem Programm und auch ihren Kandidat/innen für mehr Rechte der verschiedenen christlichen Gruppierungen einsetzt.

The HDP’s Performance in Turkey’s Authoritarian Electoral Campaign
Contrary to some predictions prior to the election, the incumbent President Recep Tayyip Erdoğan comfortably succeeded in winning the Presidential election (52.6%) without the need of a second round of voting. His party, the AKP obtained a parliamentary majority (53.7%), in coalition with the far-right MHP. However, the elections were held in an electoral environment characterised by a number of inherently antidemocratic limitations on opposition parties’ campaigns and the widespread occurrence of intimidation and violence. The experiences of the HDP exemplify some of the most blatant features of state led authoritarian interference in the campaign.
Protesting Deportations: On the Importance of Civil Disobedience
Deportations have always been a contested practice. Conservative and right-wing actors have insisted that carrying out deportations is essential for state sovereignty and application of authority. Simultaneously, by taking to the streets civil society, citizens and asylum seekers alike have practiced resistance against deportations in the form of demonstrations, petitions, blockages or hunger strikes. Their anti-deportation protests either claim the right to stay in general or focus exclusively on an acquainted person – like a neighbor or school mate – who is about to be deported. Protests against deportations are sometimes successful by stopping specific deportations; overall, they are also shaping the discourse.
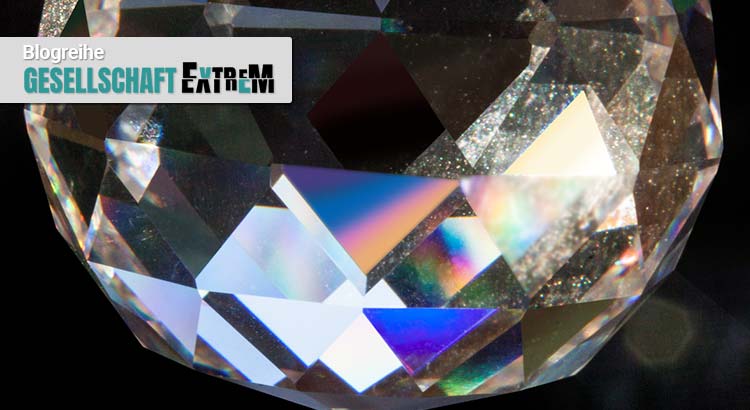
Radikalisierung und De-Radikalisierung in Deutschland: Eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung
Radikalisierung und Extremismus sowie deren Prävention werden seit einigen Jahren in Deutschland kontrovers diskutiert. Obgleich die Phänomene in diesem Themenfeld sehr unterschiedlich sein können, besteht doch Einigkeit, dass es sich bei Radikalisierung um einen Prozess handelt, der auf vielen verschiedenen Ebenen stattfindet und durch unterschiedlichste Faktoren begünstigt oder verhindert werden kann. Unsere Blogserie „Gesellschaft Extrem“ hat Einblicke in das Themenfeld geboten und sowohl Perspektiven aus der Wissenschaft, als auch aus der Praxis anhand von 21 Beiträgen erläutert. Nicht nur einzeln, sondern auch im Gesamtbild der Serie stellen die Beiträge sehr prägnant die vielseitigen Herausforderungen von individueller und kollektiver Radikalisierung sowie von Radikalisierungsprävention und deren Evaluation dar.
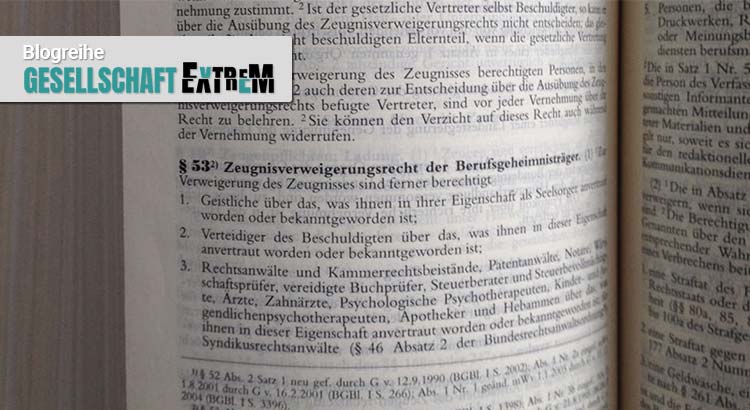
Ausstiegsberatung, Verschwiegenheit, Zeugnisverweigerungsrecht – und unsere schlechte nationale Vertrauenslage
Ausstiegsbegleitung und Distanzierung bedürfen einer vollends vertraulichen, sozialtherapeutischen Arbeitsbeziehung. Nur institutions-externe, vorzüglich nichtstaatliche Mentor*innen können sie bereitstellen – Mentor*innen, die keiner amtlichen Berichtspflicht unterliegen. Zwingend erforderlich hierfür ist ein Zeugnisverweigerungsrecht für Ausstiegsbegleiter*innen. Denn jede öffentliche Zeugenaussage stellt die Glaubwürdigkeit der gesamten bundesweiten Ausstiegsarbeit in Frage. Extremismusprävention braucht aber vor allem gesellschaftliches Binnen-Vertrauen. Jedoch die derzeitige nationale Vertrauenslage ist schlecht – besonders zwischen Behörden und Zivilgesellschaft. Der Verfassungsschutz überprüft „Demokratie leben!“, Hessen erwog eine anlasslose Sicherheitsüberprüfung, Baden-Württemberg wickelt die zivilgesellschaftlichen Ausstiegsbegleiter*innen ab und stellt weisungspflichtige Bedienstete dafür ein. Es muss noch viel miteinander geredet werden.
Mehr als nur Dienstleister: Zivilgesellschaftliche Präventionsarbeit in Deutschland
Die Präventionsarbeit ist so vielschichtig wie die Motive, aus denen sich Jugendliche und junge Erwachsene religiös-extremistischen Szenen zuwenden. Gerade deshalb ist die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure von Bedeutung. Das Engagement der Zivilgesellschaft in Deutschland ist dabei eine besondere Stärke, wie ein Blick nach Frankreich zeigt.
Radikalisierung als Flucht und kommunale Präventionsarbeit als Chance
Es ist zu einem Gemeinplatz geworden festzustellen, dass Radikalisierungsprävention eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ ist. Das liegt an der Unbestimmtheit des Begriffs und daran, dass die damit auf den Begriff gebrachte Idee noch nicht hinreichend eingelöst wurde. So werden Schule, Jugendarbeit oder Moscheegemeinden regelmäßig als Handlungsfelder bzw. Akteure von Präventionsarbeit identifiziert. Andere wichtige gesellschaftliche Institutionen hingegen, wie Kommunen, wurden häufig übersehen. In jüngerer Zeit scheint sich dies zu ändern, Gemeinden, Landkreise und Städte werden zunehmend als Orte von Prävention wahrgenommen, gute Praktiken lokaler Ansätze ausgetauscht. Der Beitrag plädiert für ein stärkeres Engagement von Kommunen in der universellen und selektiven Radikalisierungsprävention, skizziert den zu beobachtenden Trend hin zu kommunaler Radikalisierungsprävention und endet mit Empfehlungen guter Praktiken.

The Challenges and Limitations of Online Counter-Narratives
Since 9/11, policymakers and practitioners in the West traditionally employ a mix of hard- and soft-power approaches to counterterrorism. While kinetic measures such as targeted killings and arrests comprise part of the government’s response to terrorism, officials use a range of mechanisms to engage and empower populations as a means to prevent mobilization to terrorist violence. Often under the banner of “Countering Violent Extremism,”(CVE) softer measures, like intervention programming and counter-messaging initiatives, are critical mechanisms for governments and civil society alike. The execution of influential counter-narrative campaigns represents a challenging but necessary tool for stakeholders tasked with preventing and confronting the adoption of extreme ideas and actions.




